| |
|
Familiendaten der
Paul Wolfgang Merkelschen Familienstiftung Nürnberg
|
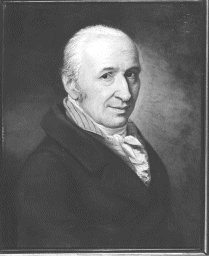 |
|
 - um 1297 - um 1297
Generation: 1
| 1. | Berthold II. Marquard Pfinzing (Sohn von Berthold I. Seifried Pfinzing und Österhild Bigenot); gestorben um 1278 / 1297. Anderer Ereignisse und Attribute:
- Beruf: Großhändler
- Beruf: Kaiserliche Burg; Ritter
- Beruf: 1274 / 1276, Nürnberg,,,,,,,,; Reichslandvogt, Reichsschultheiß
- Beruf: 1276 / 1296, Nürnberg,,,,,,,,; Reichsschultheiß
Notizen:
Ahnengemeinschaft Merkel oo Wegner: urkdl. 1264/74
Verzeichnis der Voreltern...von Paul Wolfgang Merkel, 1992 bearbeitet von Arthur Mez: Nr. XVIII. 153360
Pfinzig Merklein (aus "Vorfahren von Paul Wolfgang Merkel und Margarethe Elisabeth Bepler - Übersichten mit Kurzdaten", Arthur Mez, April 2000)
bei AL Mez (S.99)stehen als Namen nur Marquard (Merklein) Pfinzing, aber nicht Berthold II
/6063
Aufzeichnungen von EDUARD MERKEL (IV-10.03.07) über frühe Merkel-Vorfahren (alphabetisch geordnet);
ergänzt durch Anmerkungen von A. Mez und neuere Literatur;
in Maschinenschrift übertragen von Gerhard Merkel;
eingescannt und ins Ahnenprogramm eingefügt von Eberhard Brick (2004)
Pfinzing Marquardt
Aus: Nürnberger Geschlechterbuch, Merkel'sche Bibliothek, Germ. Museum Nr. 251
Die Pfinzing seintt eines der uhralten Nürnbergaschen Geschlecht, und rechte nitigene der Statt Nürnberg, so in derselben lange Zeit in guetem weßen und ansehen herkommen. Marquardt oder wie er etwan genent wird Mercklinus Pfinzing ist einer des Raths zu Nbg geweßen Anno 1264. Hatt in getachtem Jahr zwischen der Statt Nürnberg und Mainz der Zohlfreyheit halber eine ....bichung abgehandelt, hat einen Bruder gehabt Siboto genant auch des Raths, und ist vieleicht Pignot Pfinzing der gelebt Ao 1288 auch ihr Bruter gewest, und seindt zwar dieße gewißlich die Erste nicht, so dem Nürnbergischen Regiment beygewohnet, sondern haben ohne Zweifel von Alters hero daß Nürnbergische Regiment führen helffen, wie dann auch ihrer viel der. Ritterstandt geführt, und sich in
der Romischen Kayßer und König auch Chur: und Fürsten Diensten gebrauchen laßen, dann nicht allein etliche auß ihnen Schultheißen zu Nürnberg gewest, Sondern es hat auch Berdoldt Pfinzing Ritter umb das Jahr 1280 neben den Schultheißenampt auch die Nürnbergasche Reichs Vogtey verwaltet, und der wegen auff der Reichs Vestung zu Nürnberg gewohnet. Sie können aber des großen alters halber heutiges tags keinen gewißen stipitem in ihrer Genealogia anzeigen, wie man bey den alten Geschlechten mehr erfährt, sondern tetucirn unterschiedliche lineas, deren Sipschafft im Ursprung sie heutiges tags nit mehr erkundigen können. Sie haben sich auch vor alters unterschiedliche Wappen und nahmen gebraucht, dann Ihrer einstheils einen getheilten schildt, darinen ein halber adler und weißer ring, andere einen schwarz und gelb getheilten schildt geführt. Hanß Pfinzing so Ao 1344 gelebt, hat in obern Theil des getheilten schildts einen Fisch. Item Berdoldt Pfinzing, der Anno 1356 am Weinmarckh geseßen, daß Muffeßwappen geführt. Gleichsfalls haben sie die Helmkleinodt abgewechselt, dann sie auf dem schwarz und gelben schildt bißweilen Flügel, bißweilen Püffelhörner mahlen laßen. Darauf Kaißer Friderich Anno 1470 Sebaldt, Ludwig und Berdoldt den Pfinzing gebrüdern freyheit gegeben, solche obgedachte zwey Helmkleinodt auf zweyen gekrönten Thurnier Helmen zu führen, und sie darneben für Adelsgenoßen erklärt. Solch Wappen ist ihnen Ao 1489 mit einem gekrönten Löwen zwischen den Püfelhörnern, und mit geflinder noch mehr gebeßert worden. So viel die nahmen belangt, haben sich eintheils Geuschmidt genant, deßen wird bey ihren stammen dieße ursach angezeigt, daß ein uralt geschlecht diß namens in der statt Nbg gewest, welches endlich auf einer Persohn allein gestanden der eine Tochter gehabt, welche er einen Pfinzing mit dießen Beding verheurathet, daß er zugleich auch seinen nahmen und Wappen annehmen, und sowoll er alß seine nachkommen sich deßen gebrauchen solten. Und sey der schwarz und gelbe getheilte schildt der Geuschmit Wappen gewest. Daher haben etliche die Geuer-Pfinzing; so den halben Adler geführt, etliche die Geu-Pfinzing oder Geuschmitt genennet. Wann nun denn also mußten alle die Pfinzing ihr alt wappen verlaßen haben, dann sich heutiges tags keiner mehr deß wappens mit dem halben Adler allein gebraucht. Andere seindt der meinung, das wappen mit dem Adler sey der Geuschmitt gewest, wie es dann in dießem Buch ihnen zugeschrieben wirdt, und ist also der langen Zeit halber schwerlich etwas gewiß zu finden. Dem alles sey nun wie ihm woll, so wird doch die Unterschied der wappen also gefunden, und seindt die Pfinzing noch heutiges in gutten würden und ansehen, haben ieder Zeit tägliche Regiments-Personen gehabt und hat sich ihr stam dermaßen außgebreit, daß sich etliche gen Sulzbach, gen Breßlau, und antere mehr ort gesezt. In S. Sebaldts Kirch in einem Käppein neben der Sacristeyen Altar stehen ihre wappen zusam gesezt, und darbey geschrieben wappenbriefs datum 1470. Daselbsten ist auch ihr gedächtnuß in zimblicher anzahl, desgleichen unter der Voorkürch. Item etliche schilt in Baarfüßer und Pretiger Closter, auch seindt schildt oder zwen in S. Egidien Kirchen weg gethan worden. Zur Zeit des Thurniers der zu Nbg gehalten worden Anno 1198 wird eines gedacht Niclaus genandt unter den zehen von einem Erbarn Rath auß ihren mittel verordneten Persohnen, so alle notturfft zum Thurnier verschaffen solten. Eß wirt auch eines gemelt Andrea Geud genandt, mit den Zunamen Pfinzing, so Cammermeister geweßen ist, doch seindt sie nit im ritt oder Fütter Zettel, der Bekleidung des Kayßers zu Thonauwerdt darauß abzunehmen, daß vielleicht mehr erbare Geschlecht zu Nbg gewohnt haben, welche entweder mit tauglichen Personen oder sonsten zu Reutterey nit versehen gewest. Eß befinden sich auch Pfinzing im Niderlandt, ob sie aber dießen Nürnbergischen zugehören, ist nicht bewust, ist auch von ihnen nichts zu befinden, dan daß Carl Holzschuer der Erste Loßunger der gestorben ist Ao 1422 eine Pfinzingin auß Nidlandt zur ehe gehabt, bey deßen schildt in S. Sebaldts Kirch daß schwarz und weiße schildtlein stehet.
/6063
Aufzeichnungen von EDUARD MERKEL (IV-10.03.07) über frühe Merkel-Vorfahren (alphabetisch geordnet);
ergänzt durch Anmerkungen von A. Mez und neuere Literatur;
in Maschinenschrift übertragen von Gerhard Merkel;
eingescannt und ins Ahnenprogramm eingefügt von Eberhard Brick (2004)
P f i n z i n g Biedermann Tab. 390.
=============
Pfinzing ist eines der ältest- u. berühmtesten adelichen Geschlechter, welches außer etlich einzelnen Personen u. Nebenlinien, jederzeit in und um Nürnberg gewohnet, daselbsten schon in den grauesten Zeiten biß auf den heutigen Tag zu Rath gegangen, und die höchsten Ehrenstellen darinnen bekleidet hat. Dieses Hauß besitzet dermalen die adelichen Land-Güter Henfenfeld bey Herspruck, Gründlach zwischen Erlangen und Nürnberg gelegen, und auch einen considerablen Antheil am Schloß und. Dorff Kirchen-Sittenbach ohnweit Herspruck.
Aus: WILL, Nürnbergische Münzbelustigungen, Altdorf 1764 Teil I S.5 Merkelsche Bibliothek Nr.17a
Wir wundern uns, daß nirgends, auch nicht einmal in den besten geschriebenen Nachrichten, von dem Stammhause und dem Ursprung des Namens der Pfinzing Meldung geschehen ist: und gleichwol sind wir so leicht, als unserer Meynung nach überzeugend, auf beydes gekommen. In dem Hochstift Eichstädt und dessen Oberamte, die Landvogtey genannt, liegt eine Stunde unterhalb der Residenzstadt Eichstädt ein altes Ort und nur fürstliches Lustschloß, Pfünz, oder Pfünzen. (S. Büschings neuer Erd-Beschreibung III. Theil, p.1641 der zweyten Auflage, woselbst auch gemeldet wird, daß dieses Schloß 1475 an das Bißthum sey verkaufet worden.) Auf demselben saß ein altes adeliches Geschlecht der Herren von Pfünzen, oder der Pfünzener,(Pfünzenarii, wie sie lateinisch genennet werden;) und dieß ist außer Streit einerley mit Pfünzinger, Pfinzig und Pfinzing. A.1282 übergab Albrecht von Pfünzen, mit seiner Frauen. Benedicta, und seinen Erben Albrecht und Ulrich, sein Schloß und Hofrast zu Pfünzen mit Wiesen und Feldern (domum suam lapideam cum area, pratis et agris) dem Bischoff und der Kirche zu Eichstädt zu Lehen, doch so, daß er sich darauf das Ius Castellaniae, oder die Burghut, für sich und seine Erben beyderley Geschlechts, vorbehielt. In der darüber ausgefertigten Urkunde nennt ihn der Bischof Reimboto selbst Dominum Albertum de Pfünzen. (S. Falckenst. Cod. Dipl. Antt. Nordg. p. 74. sq.)Eben dieser Albrecht von Pfünzen verpfändete auch im Jahre 1282 seine Wiese bey der Almosenmühl an besagten Bischoff von Eichstädt. (S. Falckenst. l. c. p. 76 u. p. 108 wo in einer Urkunde von 1299 auch eines Waldes Pfünzen gedacht wird, der dem Bischoff gehörte.) Von diesen Pfünzenern nun müssen einige nach Nürnberg gegangen seyn und sich daselbst niedergelassen haben, und zwar wenigstens zu Ende des 12. Jahrhunderts: denn um diese Zeit findet man gewisse Spuren von ihrem Daseyn in Nürnberg; und der Rathschreiber Müller sagt in den Nürnbergischen Jahrbüchern, daß das uralte Geschlecht der Pfinzinge rechte Indigenae gewesen, die in der Stadt Nürnberg lange Zeit in gutem Wesen hergekommen sind. CONRAD PFINZING aber, der seine freyeignen Güter zu Ödenberg, bey Nürnberg gelegen, dem Bischoff zu Eichstädt, vermuthlich aus alter Treue gegen dieses Hochstift, zu Lehen aufgetragen, nennt sich -in der Übergabs-Urkunde von 1304 noch Pfünzener. Ego Conradus Pfunzenarius miles germanus in ciuitate Nurnberg - spricht er von sich. (S. Falckenst.l.c.p.120 sq.) Wenn er sich militem in ciuitate Nurnberg nennt,so ist nichts anders als ciuis drunter zu versteheh.Miles und eiuis honestus iuratus sind damals für eins genommen worden;und so wie die Ministeriales nach dem Hofrecht,oder in Hofdiensten,also haben die Milites nach dem Lehnrechte auf dem Land und in den Städten gelebet, und haben von ihnen die adelichen Gschlechter, oder Patricii, vornehmlich ihren Ursprung genommen.(S. Singularia Norimberg. p. 232 sqq.) Dieser Conrad Pfünzener steht aber auch wirklich in der Stammtafel der Herrn Pfinzinge.Von seinem Vater und Bruder, Berthold dem I.und II., stammen alle Pfinzinge auf heute ab. Sein Bruder Berthold der II. war einer der ansehnlichsten Männer seiner Familie. Er ist nicht nur Reichs-Schultheis, sondern auch Reichs-Landvogt auf der Kaiserlichen Burg zu Nürnberg gewesen und hat von des Reichs wegen zu der Burg inne gehabt Herspruck, Auerbach, Hohenstein, Neumarkt, Altdorf und Schwabach, zu deren Beschützung.er auch beständig eine Anzahl Reißiger halten mußte.(S. is. Peyer de Flaach diss. de Aduocatis Ciuitt. Imp. Circ. Franc. §19 p. 54)
Gestorben:
bei Zeller&Fiala bzw. Schüz&Weitbrecht 1297
Berthold heiratete Els Isolt gen. Probst vor 1240 in Nürnberg,,,,,,,,. [Familienblatt] [Familientafel]
Kinder:
- Berthold III. Pfinzing gestorben in 1320; wurde beigesetzt nach 1322 in Nürnberg,,,,,,,,.
- Hedwig Pfinzing
- Elisabeth Pfinzing
- Pfinzing
- Schultheiß Markward Pfinzing
|
Generation: 2
| 2. | Berthold I. Seifried Pfinzing (Sohn von Endres Pfinzing). Anderer Ereignisse und Attribute:
- Beruf: Ritter
- Beruf: 1233, Kloster Heilsbronn; Dienstmann
Notizen:
Verzeichnis der Voreltern...von Paul Wolfgang Merkel, 1992 bearbeitetvon Arthur Mez: Nr. XIX. 306720
/6063
Aufzeichnungen von EDUARD MERKEL (IV-10.03.07) über früheMerkel-Vorfahren (alphabetisch geordnet);
ergänzt durch Anmerkungen von A. Mez und neuere Literatur;
in Maschinenschrift übertragen von Gerhard Merkel;
eingescannt und ins Ahnenprogramm eingefügt von Eberhard Brick (2004)
P f i n z i n g Biedermann Tab. 390.
=============
Pfinzing ist eines der ältest- u. berühmtesten adelichen Geschlechter,welches außer etlich einzelnen Personen u. Nebenlinien, jederzeit in undum Nürnberg gewohnet, daselbsten schon in den grauesten Zeiten biß aufden heutigen Tag zu Rath gegangen, und die höchsten Ehrenstellendarinnen bekleidet hat. Dieses Hauß besitzet dermalen die adelichenLand-Güter Henfenfeld bey Herspruck, Gründlach zwischen Erlangen undNürnberg gelegen, und auch einen considerablen Antheil am Schloß und.Dorff Kirchen-Sittenbach ohnweit Herspruck.
Aus: WILL, Nürnbergische Münzbelustigungen, Altdorf 1764 Teil I S.5Merkelsche Bibliothek Nr.17a
Wir wundern uns, daß nirgends, auch nicht einmal in den bestengeschriebenen Nachrichten, von dem Stammhause und dem Ursprung desNamens der Pfinzing Meldung geschehen ist: und gleichwol sind wir soleicht, als unserer Meynung nach überzeugend, auf beydes gekommen. Indem Hochstift Eichstädt und dessen Oberamte, die Landvogtey genannt,liegt eine Stunde unterhalb der Residenzstadt Eichstädt ein altes Ortund nur fürstliches Lustschloß, Pfünz, oder Pfünzen. (S. Büschings neuerErd-Beschreibung III. Theil, p.1641 der zweyten Auflage, woselbst auchgemeldet wird, daß dieses Schloß 1475 an das Bißthum sey verkaufetworden.) Auf demselben saß ein altes adeliches Geschlecht der Herren vonPfünzen, oder der Pfünzener,(Pfünzenarii, wie sie lateinisch genennetwerden;) und dieß ist außer Streit einerley mit Pfünzinger, Pfinzig undPfinzing. A.1282 übergab Albrecht von Pfünzen, mit seiner Frauen.Benedicta, und seinen Erben Albrecht und Ulrich, sein Schloß und Hofrastzu Pfünzen mit Wiesen und Feldern (domum suam lapideam cum area, pratiset agris) dem Bischoff und der Kirche zu Eichstädt zu Lehen, doch so,daß er sich darauf das Ius Castellaniae, oder die Burghut, für sich undseine Erben beyderley Geschlechts, vorbehielt. In der darüberausgefertigten Urkunde nennt ihn der Bischof Reimboto selbst DominumAlbertum de Pfünzen. (S. Falckenst. Cod. Dipl. Antt. Nordg. p. 74.sq.)Eben dieser Albrecht von Pfünzen verpfändete auch im Jahre 1282seine Wiese bey der Almosenmühl an besagten Bischoff von Eichstädt. (S.Falckenst. l. c. p. 76 u. p. 108 wo in einer Urkunde von 1299 auch einesWaldes Pfünzen gedacht wird, der dem Bischoff gehörte.) Von diesenPfünzenern nun müssen einige nach Nürnberg gegangen seyn und sichdaselbst niedergelassen haben, und zwar wenigstens zu Ende des 12.Jahrhunderts: denn um diese Zeit findet man gewisse Spuren von ihremDaseyn in Nürnberg; und der Rathschreiber Müller sagt in denNürnbergischen Jahrbüchern, daß das uralte Geschlecht der Pfinzingerechte Indigenae gewesen, die in der Stadt Nürnberg lange Zeit in gutemWesen hergekommen sind. CONRAD PFINZING aber, der seine freyeignen Güterzu Ödenberg, bey Nürnberg gelegen, dem Bischoff zu Eichstädt,vermuthlich aus alter Treue gegen dieses Hochstift, zu Lehenaufgetragen, nennt sich -in der Übergabs-Urkunde von 1304 nochPfünzener. Ego Conradus Pfunzenarius miles germanus in ciuitate Nurnberg- spricht er von sich. (S. Falckenst.l.c.p.120 sq.) Wenn er sich militemin ciuitate Nurnberg nennt,so ist nichts anders als ciuis drunter zuversteheh.Miles und eiuis honestus iuratus sind damals für eins genommenworden;und so wie die Ministeriales nach dem Hofrecht,oder inHofdiensten,also haben die Milites nach dem Lehnrechte auf dem Land undin den Städten gelebet, und haben von ihnen die adelichen Gschlechter,oder Patricii, vornehmlich ihren Ursprung genommen.(S. SingulariaNorimberg. p. 232 sqq.) Dieser Conrad Pfünzener steht aber auch wirklichin der Stammtafel der Herrn Pfinzinge.Von seinem Vater und Bruder,Berthold dem I.und II., stammen alle Pfinzinge auf heute ab. Sein BruderBerthold der II. war einer der ansehnlichsten Männer seiner Familie. Erist nicht nur Reichs-Schultheis, sondern auch Reichs-Landvogt auf derKaiserlichen Burg zu Nürnberg gewesen und hat von des Reichs wegen zuder Burg inne gehabt Herspruck, Auerbach, Hohenstein, Neumarkt, Altdorfund Schwabach, zu deren Beschützung.er auch beständig eine AnzahlReißiger halten mußte.(S. is. Peyer de Flaach diss. de Aduocatis Ciuitt.Imp. Circ. Franc. §19 p. 54)
/6063
Aufzeichnungen von EDUARD MERKEL (IV-10.03.07) über früheMerkel-Vorfahren (alphabetisch geordnet);
ergänzt durch Anmerkungen von A. Mez und neuere Literatur;
in Maschinenschrift übertragen von Gerhard Merkel;
eingescannt und ins Ahnenprogramm eingefügt von Eberhard Brick (2004)
FRANKEN TAGESZEITUNG 16.2.1939
HENFENFELD
Ein schöner Ausflugsort im Pegnitztal
Henfenfeld kennt man im „Fränkischen" als einen beliebten Ausflugspunktim mittleren Pegnitztal, hauptsächlich als Ausgangspunkt für schöneWanderungen nach dem Klosterdorf Engeltal mit feiner Heilstätte, auf denArzberg und zum Keilberg. Henfenfeld ist Station der sogen. Ostbahn, dievon Nürnberg am linken Pegnitzufer nach Amberg und in die BayrischeOstmark führt. Von der Reichsstraße Nürnberg-Hersbruck führt eineFabrstraße bei Altensittenbach südwärts über Henfenfeld nachOffenhausen, eine andere mehr westlich, von dieser abzweigend, überGersdorf nach Altdorf.
Der Ort zeichnet eich durch eine bevorzugte landwirtschaftliche Lageaus; laubwaldbedeckte Höhen umgeben ihn und stolz ragt aus der Ortsmittedas stattliche Schloß empor. Der Name Henfenfeld war ursprünglich einFlurname und besagt; daß auf den Feldern Hanf gebaut wurde. In derGeschichte erscheint Henfenfeld urkundlich bereits im Jahre 1119. Vordem Jahre, 1000 gehörte es dem Bistum Eichstätt. Ein Burgsitz inHenfenfeld ist bereits im 11. Jahrhundert nachgewiesen; das damaligeKastell war der Stammsitz der Herren von Henfenfeld, die später inUrkunden wiederholt vorkommen. Der letzte Herr von Henfenfeld, dergenannt wird, war Eberhard de Henfenfeld 1382. Ende des 14. Jahrhundertskam der Besitz an die Herren von Breitenstein, dann an die Ritter vonHeimburg und an die Ritter von Wildenstein. Zu Anfang des 15.Jahrhunderts wird ein Wolfhard von Hüttenbach als Besitzer des Schlossesgenannt. Von diesem kaufte im Jahr 1405 das Schloß ein Ritter Hans vonEgloffstein. Diese Familie veräußerte es 1530 an den NürnbergerPatrizier MARTIN PFINZING; das Dorf Henfenfeld war 1504 an Nürnberggekommen. Im markgräflichen Krieg 1552/1553 wurde das Schloß in Brandgesteckt, aber wieder aufgebaut. Im Besitz der Pfïnzing verblieb dasSchloß 234 Jahre, bis es nach Aussterben dieses Geschlechts an dieFamilie Haller von Hallerstein fiel, die es 1817 an Benedikt von Schwarzauf Artelshofen und Hirschbach verkaufte. Im Mai 1934 wurde in einembesonderen Trakt des Schlosses die „Gauschule Franken desNS-Lehrerbundes" eingerichtet, die erste Gauführerschule dieser Art inFranken. Die Schule hat die Aufgabe, die Erzieherschaft Frankens nachden Richtlinien des Reichsschulungsamtes durchzuschulen unb zwar nichtin erster Linie wissenschaftlich, sondern in weltanschaulicher undpolitischer Hinsicht durch das Erleben der Gemeinschaft.
Das über dem Ort thronende, von einem Garten und großem Park umgebenewohlerhaltene Schloß ist eine Zierde der Landschaft. Es birgt in seinenGemächern manche historische Erinnerung. Fenster und Wände sind mit denWappen der Herren von Pfinzing, von Haller, von Tucher, von Ebnergeschmückt. Von den Fenstern genießt man eine herrliche Aussicht.Ueberaus sehenswert ist auch die Pfarrkirche mit Ihrem wertvollen altenKunstgut an Malerel und Plastik. Sie stammt in ihren Grundfesten nochaus der romanischen Zeit unb ging aus einer Kapelle hervor. DieseNikolauskapelle ist um das Jahr 1400 zur Marienkirche erweitert worden.Der Turmbau mit dem originellen Anbau der Taufglocke im Jahre 1791; dasLanghaus ist größtenteils ein Werl des 16. Jahrhunderts. Neben dem Turmbefindet sich der pompöse Eingang zur Gruft der Herren von Pfinzing.Sehr kunstvoll gearbeitet ist das Rittergrabmal des 1764 gestorbenenJOHANN SIGMUND VON PFINZING; es ist eine Schöpfung des berühmtenBamberger Bildhauers Mutschelle. Der Chor zeigt zahlreiche Wappen undsechs Glasgemälde aus der Dürerschule. In der Nähe des Bahnhofes hat manvor Jahren in den Aeckern ein Gräberfeld der Hallstatt-Stufe gefunden.Die dabei gemachten Ausgrabungen befinden sich im Besitz derNaturhistorischen Gesellschaft in Nürnberg. Die Häuser mit den hohenGiebeln und den mehrfach übereinander liegenden Hopfenböden sindcharakteristisch für den Ort, in dessen Umgebung ja der Hopfenanbauallenthalben anzutreffen ist.
Berthold heiratete Österhild Bigenot. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Österhild Bigenot Notizen:
Quellen: Mitt.d.Ver.f.Gesch.d.Stadt Nürnberg 49 (1959) 34 ff.: G.Wunder,Pfinzing die Alten
AL Stawitz (wohl hauptsächlich aus obiger)
Biedermann (vielfach durch obige überholt)
(A.Mez,S.142)
|
Generation: 3
| 4. | Endres Pfinzing Anderer Ereignisse und Attribute:
- Beruf: vor 1197, Kaiser Heinrich VI.; Kammermeister
Notizen:
Verzeichnis der Voreltern...von Paul Wolfgang Merkel, 1992 bearbeitet von Arthur Mez: Nr. XX. 613440
geleitete den Kaiser mit 12 Pferden nach Donauwörth, vor 1197 Kammermeister, war den Turniervögten zugeordnet
Auszüge aus einer kopierten Einlage bei
/6065
Aufzeichnungen von EDUARD MERKEL (IV-10.03.07) über frühe Merkel-Vorfahren (alphabetisch geordnet);
ergänzt durch Anmerkungen von A. Mez und neuere Literatur;
in Maschinenschrift übertragen von Gerhard Merkel;
eingescannt und ins Ahnenprogramm eingefügt von Eberhard Brick (2004)
„PFINTZING DIE ALTEN"
(6065)
[Der Dank des Verfassers gilt für freundliches Entgegenkommen und die gebotene Gelegenheit zur Einsicht in die Quellen den Herren Direktor Dr. Schnelbögl vom Staatsarchiv, Professor Dr. Pfeiffer vom Stadtarchiv Nürnberg und ihren Mitarbeitern sowie Herrn Baron Helmut Haller von Hallerstein in Großgründlach.
Mehrfach zitiert wurden:
NUB: Nürnberger Urkundenbuch Lieferung 1-4, herausgegeben vom Stadtarchiv Nürnberg.
U. St.: Ulman Stromer, herausgegeben von Karl Hegel, Die Chroniken der deutschen Städte, Nürnberg Band 1, Leipzig 1862.
Ho: Das Handlungsbuch der Holzschuher in Nürnberg, hrsg.. von Anton Chroust, Hans Proesler (Veröff. d. Gesellsch. f. fränk. Gesch.), Erlangen 1934.]
EIN BEITRAG ZUR GESCHICHTE DES NÜRNBERGER PATRIZIATS
- HERRN PFARRER GEORG LENCKNER ZUM 70. GEBURTSTAG IN DANKBARKEIT ZUGEEIGNET -
VON GERD WUNDER
{S. 34+35 - MVGN 49 (1959) Pfinzing} Entstehung und Struktur des Patriziats unserer alten Städte werfen Fragen auf, die schon viele Forscher beschäftigt haben. Erst mehrere Untersuchungen" über einzelne Familien können, wie Hirschmann bemerkt hat [Mitt. d. Vereins f. Gesch. d. Stadt Nürnberg 1950, S.259.], das Gesamtbild hervortreten lassen und ein Urteil zu den soziologischen Problemen ermöglichen. Unter den Nürnberger Familien des 13. und 14. Jahrhunderts nehmen die Pfinzing geradezu eine Schlüsselstellung ein; das Statut der „Eltern Herrn" von 1521 nennt unter den alten Geschlechtern an erster Stelle "Pfintzing die alten" [Die Chroniken der deutschen Städte, Nürnberg I, 216.], Siegmund Meisterlin spricht von den „Pfinzing mechtig" [Die Chroniken der deutschen Städte, Nürnberg III, 96.], und Konrad Haller nennt sie in seinem großen Geschlechterbuch [Staatsarchiv Nürnberg, Nürnb. Hdschr. 211. ] an erster Stelle, noch vor seiner eigenen Familie. Wenn die Pfinzing auch im Mannesstamm 1764 ausstarben, so sind sie doch durch ihren Kinderreichtum, die Heiraten ihrer Töchter und ihr vielfaches Erbe in das gesamte spätere Patriziat eingegangen. Das rechtfertigt den Versuch, an Hand des Nürnberger Urkundenbuchs und anderer zeitgenössischer Quellen die Anfänge dieser Familie zu untersuchen; heraldische, besitzgeschichtliche und wirtschaftsgeschichtliche Arbeiten könnten ergänzen, was hier mit rein genealogischen Methoden unternommen wird; doch bietet bereits die Genealogie gewisse Einblicke in die Sozialstruktur und stellenweise sogar in die Denkweise des mittelalterlichen Stadtadels.
Ausgelassen die die Stammtafeln und die Kapitel:
1. Die Anfänge der Familie (S. 35)
2. Sibots Stamm (S. 38)
3. Bertolds Stamm (S. 43)
4. Ergebnisse (S. 54)
Überblicken wir die bisher gewonnenen V o r n a m e n in der Familie Pfinzing, so ergibt sich, daß Bertold, Markwand und auch Sibot typische Namen der Familie sind. Gerade der bevorzugte Name Bertold ist allerdings nicht so selten, daß wir ihn von der Sippe des Schultheißen ableiten müßten. Ulman Stromer zählt 11, das Handlungsbuch der Holzschuher 10 Bertolde außer den Pfinzing auf, und gewiß ist davon nur ein Teil diesem Sippenkreis zuzuschreiben. Zudem hat sich gezeigt, daß nicht nur in der Linie des Schultheißen Bertold, sondern auch in der seines Vetters der Name mehrfach vorkommt. Das dürfte den Schluß zulassen, daß die Namen nicht nur von unmittelbaren Vorfahren oder ihren Geschwistern vererbt wurden, sondern daß auch Vettern des gleichen Geschlechts ihre Kinder nach einem angesehenen Verwandten, von dem sie selbst nicht abstammten, nennen konnten, vielleicht sogar nach Schwägern. Gewiß bestand nicht der moderne Brauch freier Namenswahl; die Namengebung nach dem Paten ist auch noch nicht bezeugt; aber die Namen wurden nicht nur aus der engsten Verwandtschaft, sondern aus dem weiteren Sippenkreis genommen. Einleuchtend ist, daß die Namen Fritz, Leupold und wohl auch Heinrich von den Holzschuhern in die Familie kamen; der für die Holzschuher und die von Gründlach typische Name Herdegen fehlt bei den Pfinzing, kommt aber bei ihren Nachkommen Beheim vor. Der seltene Name Bigenot in der Sippe Sibots ebenso wie in der Familie Ebner dürfte auf das ausgestorbene Geschlecht des Bigenot zurückgehen. Der Name des vermuteten Stammvaters Sigfrid findet sich erst nach über 100 Jahren wieder in der Familie, doch war Sibot ein Name aus verwandter Wurzel. Auffallend ist das Auftreten des Namens Christian bei den Kindern und Enkeln des Bertold Pfinzing und der Jeut Ebner; gewiß ist hier die heilige Nonne Christine Ebner, die Schwester der Mutter, namengebend gewesen. Die fromme Gesinnung des Ehepaars Bertold und Jeut kommt ja gleichzeitig in mehreren Stiftungen an die Dominikanerinnen von Engeltal, an die Prediger in Nürnberg und an die Zisterzienser in Heilsbronn zum Ausdruck [Regesten Stadtarchiv, 4. 4. 1331, 16. 1. 1332, 21. 1. 1332, 25. 5. 1333 (2 Urk.), 14. 1. 1335, 26. 6. 1335, 10. ß. 1336.]. Dieser von einer tiefen inneren Frömmigkeit erfüllten Generation gehörte auch der reiche Konrad Groß an, der nicht nur zahlreiche Stiftungen gemacht hat, sondern auch den Gebetsbruderschaften zahlreicher Klöster beitrat. Der Stil dieser Stiftungen und ihr Umfang verrät eine mehr {S. 54 - MVGN 49 (1959) Pfinzing} als herkömmliche religiöse Gesinnung, und die Töchter der Familie, die unter der Obhut der Christine Ebnerin aufwuchsen, mögen nicht nur aus Versorgungsgründen im Kloster geweilt haben. In Margarete Pfinzing hatte Engelthal 1379 eine Priorin, eine andere Margarete Pfinzing war 1363, Katharine 1411 Äbtissin bei den Klarissen. Daß der Schwager der Christine Ebnerin, Bertold Pfinzing, der mehrfach Stiftungen für Engelthal gemacht hat, wo er zwei Schwestern und eine Tochter besaß, „des Klosters guter Freund" heißt (1535), mag daher nicht nur im mittelalterlichen, sondern auch im modernen Sinne des Wortes stimmen.
Fragen wir nach der wirtschaftlichen Grundlage dieser Stiftungen und des Ansehens der Familie überhaupt, so bleiben wir auf Vermutungen angewiesen. Von keinem einzigen Pfinzig ist uns das überliefert, was wir modern den Beruf nennen würden; sie treten in den Urkunden als Zeugen und Salmannen auf, vor allem aber in den bürgerlichen Ehrenämtern der Gemeinde. Freilich wüßten wir ohne den glücklichen Zufallsfund des Handlungsbuches auch von den Holzschuhern nicht, daß sie Gewandschneider waren und mit flandrischen Tuchen handelten. Ganz gewiß besaßen die Pfinzing Häuser und Grundstücke in Nürnberg, aber mit jeder Heirat verändern sich die Eigentumsverhältnisse; ein Familienbesitz" im Sinne eines Majorats im Mannesstamm ist nicht festzustellen. So hat 1336 Bertold Pfinzing von seinem Sehweher (Ebner) die Brotbänke bei St. Sebald, und seine Kinder haben 1344 ein, Erbrecht an den Kramen bei St. Sebald. Konrad Pfinzing kauft 1282 den halben Butiglerhof, und der 1317 genannte Konrad „uf dem Hofe" mag identisch sein mit Konrad, Herrn Konrads Sohn. Der ältere Konrad, der Ritter, besitzt 1304 in Ödenberg eichstättische Lehen; wenn im Eichstätter Lehenbuch ein Berchtold Pfinzing ebendort Lehen hat (der Schultheiß oder sein Vetter), so ist damit nicht gesagt, ob es sich um dieselben Stücke oder um benachbarte Stücke aus der gleichen Erbportion handelt. Neben den eichstättischen werden burggräfliche Lehen erwähnt (z. B. der Garten hinter der Burg, den Bertold 1329 seinem Sohn abtritt), aber auch w?rzburgische Leben eines Konrad (in Teufenstadt 1364). Zuweilen, besonders anläßlich der frommen Stiftungen, werden uns Äcker, Wiesen, Gälten und Zehnten an verschiedenen Orten im weiteren Umkreis genannt: Bertold verkauft 1328 an Heilsbronn Zehnten in Meiersperg und verzichtet 1331 nochmals ausdrücklich; er hat 1332 ein Eigengut in Hansheim, 1332 Reichenecker Leben, 1333 erkauften Besitz in Sperbersloh und ein von seiner Schwester Eslerin erkauftes Eigengut in Milzach, 13 3 5 Güter in Glitzendorf; die Witwe seines Bruders Fritz ist 1344 in Traishöchstädt begütert, dessen Sohn Heinrich 1351 in Klein-Gründlach, und Bertolds Enkel Koler hat 1371 ein Gut in Solern vom Großvater ererbt. Nur eingehende örtliche Untersuchungen, die auch spätere Aufzeichnungen zur Hilfe nehmen, könnten eine genauere Besitzfolge herzustellen versuchen; stets müßte dabei aber auch bedacht werden, daß es sich ebensogut um dieselben wie um benachbarte Güter am gleichen Ort handeln kann, daß Vererbung und Kauf (zunächst Kauf innerhalb der Miterbenschaft, aber auch Geldanlage zur Abrundung oder Ergänzung des Besitzes) den Bestand dauernd verändern. Erst 1530 haben {S. 56 - MVGN 49 (1959) Pfinzing} die Pfinzing mit Schloß Henfenfeld einen Mittelpunkt ländlicher Besitzungen erworben. Soviel ergeben doch auch die verstreuten Erwähnungen in unserem Urkundenmaterial, daß von einer Bevorzugung des Mannesstamms bei der Besitzvererbung nicht die Rede sein kann. Immerhin bieten die Quellen eine Grundlage für eingehendere besitzgeschichtliche Untersuchungen. Doch dürfen wir schon jetzt sagen: die Pfinzing lebten wohl vorwiegend von Haus- und Grundbesitz, von Renten und Gülten. Haben sie darüber hinaus Geldgeschäfte getätigt und Warenhandel getrieben? Jener Konrad, der um 1372 Reichssteuern einzog, und die Brüder Ulrich und Bertold, die unter König Wenzel die Judensteuern zugeschrieben erhielten, dürften wohl den Königen vorher bereits mit Geld ausgeholfen haben; sie sind zweifellos Männer, die über größere Beträge von Bargeld verfügten und damit nicht nur Fürsten finanzierten, sondern auch nach dem Kerbholz und ohne urkundliche Verschreibung Geld an Privatleute liehen. Ein Markwand Pfinzing verkaufte 1358 Waren nach Italien, und Franz Pfinzing gehörte 1410 zu den Kaufleuten, die mit Venedig Handel trieben. Auch der von Ulman Stromer erwähnte Bigenot Pfinzing, der viel in Lamparten war, wird dort geschäftliche Verbindungen gehabt haben. Aber wie weit kann man aus diesen späteren Angaben auf die Zeit um 1300 zurückschließen? Da wir kein Handlungsbuch, wie bei den Holzschuhern, haben, wissen wir es nicht; bei den Holzschuhern kam der Schwager Pfinzing nur als Kunde, nicht aber als Geschäftsfreund vor. Wir werden uns also vor Verallgemeinerungen hüten müssen; einige Mitglieder der Familie Pfinzing haben in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts Geld- und Warengeschäfte gemacht; daß solche Geschäfte für einen vornehmen Nürnberger Bürger nicht standeswidrig waren, beweist das Handlungsbuch der Holzschuher. Aber es handelt sich dabei immer um einzelne Mitglieder der Familie; die Familie bildet keineswegs eine Einheit im Mannesstamm, einzelne Mitglieder können den Wegen mütterlicher Verwandter folgen, und ob ein Familiengefühl etwa der Pfinzinge, der Ebner usw. bestand, sagen unsere Quellen nicht. Zwar hebt Ulman Stromer die Angehörigen seines Namensstammes durchaus hervor, aber auch seine Verwandten von den Esler und Pfinzing her stehen ihm nahe. Das einzige, was wir über die Denkweise der Menschen wissen - die Namengebung - verrät Zusammenhänge, die über die Mannesstammfamilie hinausreichen.
Mehr als über die wirtschaftliche und berufliche Stellung verraten unsere Urkunden über die s o z i a 1 e S t e 11 u n g der Nürnberger Geschlechter, über ihre Mitwirkung in der Gemeinde. Sibot Pfinzing ist 1251 der dritte, 1253 der zweite und 1263 der erste des Gerichts nach dem Schultheißen; er gehört demnach bereits der Körperschaft an, die 1254 „Universitas civium", Bürgergemeinschaft, genannt wird und aus der der Rat hervorgeht. Sein Bruder Merklin heißt honestus vir, ehrbarer Mann, oder vir discretus ac fidedignus, bescheidener und glaubwürdiger (d. h. sachkundiger und bevollmächtigter) Mann. Für diese Personen ist in den Urkunden seit 1276 meist die Anrede Herr gebräuchlich, die bisher Geistlichen und Rittern vorbehalten gewesen war. Später werden die Pfinzing als Schöffen und Geschworene bezeichnet, sie gehören häufig in Rechtshändeln zu dem kleinen Kreise der {S. 57 - MVGN 49 (1959) Pfinzing} Schiedsmänner, so der alte Bertold 1322 im Auftrag des Königs Ludwig in der Judensache. Häufig finden wir zwei Brüder gleichzeitig im Schöffen- oder Ratskollegium, so Siboto und Merklin, dann Bertold und Markward, dann Bertolds Söhne Bertold und Fritz" [universitas civium (NUB 353); Schöffen und Genannte NUB 539; consults et universitas civium NUB 734; consults et scabini NUB 761; scabini NUB 766; burger gemeinlich des rats und der schepphen NUB 814; Schephen NUB 830. Dazu Murr, Journal (s. Anm. S. 367-372; Die Chron. d. dt. Städte I N?rnberg S. 217 Anm.)]. Zu der Zeit, als der entstehende Rat dem Schöffenkollegium gegenübersteht, finden wir Vertreter der gleichen Familien, zuweilen sogar die gleichen Personen in beiden Körperschaften; damit ist die juristische Trennung dieser Gremien faktisch bereits weitgehend eingeschränkt, ihre spätere Verschmelzung vorbereitet. Unter den Schöffen des Landgerichts sitzen die Pfinzing wie die anderen Nürnberger Bürger gleichberechtigt mit den Angehörigen des Landadels, so 1282, 1296, 1299 [Als Urteilsprecher des Landgerichts Bertold Pfinzing alt Schultheiß ... Leupold Holzschuher (NUB 906), vgl. NUB 668, 674, 909, 922, 1044 und Mitt. Nürnberg 1934. S.17.]; daraus darf man wohl weniger ihre individuelle Gleichstellung mit dem Landadel, als die rechtliche Gleichstellung der Stadtgemeinde folgern, die sie vertraten. Unter den Genannten des größeren Rats finden wir 1317 Sibot, jung Berchtold und Chunrat Pfinzing, 1319 unter den „consules" (Ratsherrn) Perhtold, unter den Schöffen Friedrich, unter den Genannten Michel, Sibot, Chunrat und Johann Pfinzing. 1332 steht an der Spitze der consules (Ratsherrn) Bertold Pfinzing der ältere, an 10. Stelle unter den Schöffen sein Neffe Konrad Pfinzing Friedrichs Sohn. Von Merklin Pfinzing, der 1264 in Main_ gegenseitige Zollfreiheit vereinbarte, bis zu Bertold, der unter König Wenzel und Ruprecht ein großer Mann war, und seinem Sohn Sebald, dem kaiserlichen Rat Sigmunds, sind sie auch in der Außenpolitik und Diplomatie der Reichsstadt hervorgetreten.
Ihren besonderen Ausdruck findet diese bedeutende Stellung der Pfinzing, und ihrer Verwandten darin, daß sie häufiger als andere Familien das S c h u 1 t h e i ß e n a m t innehatten. Kaum hatte die Reichsstadt unter König Rudolf Sicherheit gegenüber dem Herzog von Baiern und dem Burggrafen gewonnen, als wir einen Pfinzing, eben jenen Merklin, als königlichen Schultheißen und Vorsitzenden des Gerichts finden (1276). Er scheint bald darauf gestorben zu sein, aber seine Söhne Bertold und Markward haben nacheinander das Schultheißenamt 1281-90 inne, dann folgt von 1290 bis 1316 Bertolds Schwiegersohn Konrad Esler. Unter Bertold wird das erste Ächtungsbuch angelegt (1285); er hat nach Ulman Stromer auch das Butigleramt auf der Burg zeitweise innegehabt. Fragen wir uns nach den Ursachen des raschen Aufrückens der Familie in die vorderste Reihe der Bürgerschaft, so fällt auf, daß Merklin Pfinzing seine Sendung nach Mainz, der wir seine erste urkundliche Erwähnung verdanken, unter jenem Schultheißen Bertold Isolt genannt Propst (1258-65) anvertraut erhielt, der als erster in der königslosen Zeit die beginnende Selbständigkeit der Stadt verkörpert. Vielleicht darf mit aller gebotenen Vorsicht die Vermutung gewagt werden, daß Merklin Pfinzing der Schwiegersohn Isolts war; damit wäre der Vorname Bertold bei dem ältesten Sohn ebenso erklärt wie die Vertrauensstellung
MVGN 44 (1959) Pfinzing
Merklins, obwohl er der jüngere Bruder war. Durch den Schultheißen Bertold, der offenbar eine bedeutende Persönlichkeit war, würde dann dieser Vorname in der Familie seine vorwiegende Geltung erhalten haben. Allerdings reicht die Überlieferung zu einer sicheren Aussage darüber nicht aus. Auch die späteren Schultheißen gehören teilweise der gleichen Sippe an. Anstelle Konrad Eslers begegnet uns vorübergehend 1306 im Schultheißenamt Heinrich Geusmid, ein Neffe Bertold Pfinzings. Auch Erkenbrecht Koler 1311 gehört seiner Stellung in den Urkunden nach zum weiteren Verwandtenkreis der Pfinzing. Konrad Eslers Nachfolger war von 1317 bis 1337 Konrad Pfinzing, Eslers Neffe und Pfinzings Vettersohn. Auf ihn folgte nach kurzer Unterbrechung Konrad Groß 1338-56, der das Schultheißenamt von Kaiser Ludwig 1338 erblich verpfändet erhielt. Seine Stiefmutter war eine Esler; aber darüber hinaus besteht die Möglichkeit, daß seine Frau zum Verwandtenkreis der Pfinzing gehört (siehe Exkurs IV Konrad Groß). Es ergibt sich also folgende Verwandtschaft der Nürnberger Schultheißen: (Stammtafel weggelassen, da im Ahnenprogramm aufgenommen)
{S. 59,MVGN 44 (1959) Pfinzing} Wäre Agnes, die Frau des Bamberger Schultheißen Friedrich Zolner, oder er selbst, der das gleiche Wappen führt, verwandt mit den Pfinzing, so würden alle diese Schultheißen in eine einzige Tafel als Blutsverwandte oder Schwiegersöhne früherer Schultheißen einzuordnen sein. Aber selbst wenn dies nicht der Fall ist, wird doch ersichtlich, daß es sich um einen Kreis von Verwandten und Verschwägerten handelt, der nur durch wenige kurzfristige Zwischenbesetzungen unterbrochen ist. Ja noch 1404 finden wir einen Bertold Pfinzing, einen Urenkel des Schultheißen Bertold, „an des Schultheißen Statt“ zu Gericht sitzen. Unsere Übersicht zeigt, verglichen mit den bisher gewonnenen Lebensdaten, noch ein weiteres. Sowohl Bertold Pfinzing, wie sein Schwiegersohn Konrad Esler, wie sein Vettersohn Konrad Pfinzing gelangten in verhältnismäßig jungen Jahren, wenige Jahre nach ihrem ersten urkundlichen Auftreten, zum Schultheißenamt. Vor allem für Bertold Pfinzing ist anzunehmen, daß er nicht durch langjährige Tätigkeit und Erfahrung, sondern im Besitz jugendlicher Kraft und Initiative das höchste Amt der Reichsstadt erhielt; er ist als alter Schultheiß dann noch viele Jahre der erste Mann neben dem Schultheißen und erscheint urkundlich noch 34 Jahre nach Abgabe des Amtes. Zum Schultheißenamt gehörte damals also wohl noch Dienst im Sattel und rüstiges Alter. Noch die Söhne von Konrad Groß haben zu einer Zeit, als das Schultheißenamt seinen Inhalt bereits verändert und frühere Rechte dem Rat abgegeben hatte, den Gerichtsvorsitz verhältnismäßig jung innegehabt, der jüngere Konrad Groß hat noch über 32 Jahre nach Abgabe des Schultheißenamtes gelebt.
Die viel erörterte Frage nach dem Ursprung des P a t r i z i a t s läßt sich für die Pfinzing nur indirekt beantworten. Nur einer von ihnen ist im Besitz der Ritterwürde bezeugt, Konrad, und dieser anscheinend auch erst in reiferen Jahren. Bertold Pfinzing, der Schultheiß, von dem sein Urgroßneffe Ulman Stromer behauptet, er sei ein Ritter gewesen, war es bestimmt nicht. Der erste in der Überlieferung faßbare Pfinzing war ein Dienstmann des Klosters Heilsbronn; diese Tatsache und die Eichstätter Lehenb?cher lassen auf seine Herkunft aus dem Ministerialenstand schließen, nach Krafts einleuchtendem Hinweis vielleicht auf den Ort Pfünz bei Eichstätt [Freundliche Mitteilung von Dr. W. Kraft.] Dazu kommt, daß die beiden überlieferten Pfinzingwappen, das eine gold und schwarz geteilt, das andere mit dem schwarzen Adler im goldenen Felde und darunter dem silbernen Ring im roten Felde, ebenfalls auf Dienstmannen des Reichs schließen lassen. Zwar sind in den Zeugenreihen aller echten Urkunden die Nürnberger Bürger und Schöffen rechtlich klar von den ländlichen Dienstmannen des Reichs oder des Burggrafen geschieden, aber sie sind ihnen doch wohl gesellschaftlich gleich gewesen. Darauf läßt nicht nur die gesicherte Herkunft mehrerer Nürnberger Familien aus der Ministerialität, sondern auch die Tatsache etlicher Heiratsverbindungen, wie z. B. der Verwandtschaft der Holzschuher mit den letzten Gründlachern, schließen. Hätte man einem Patrizier des 14. Jahrhunderts die Frage des 19. Jahrhunderts vorgelegt: „Ritter oder Kaufmann?", so hätte er vermutlich keine Antwort gewußt. Denn wenn die Mutter der Holzschuher eine Ministerialentochter {S. 60, MVGN 49 (1959) Pfinzing } war, sie aber den großen Handel mit teuren Tuchen betrieben, der Schultheiß Pfinzing ihr Schwager war, seinerseits wohl ministerieller Herkunft, aber ein Vorfahr späterer Geld- und Handelsleute, dann bestand offenbar keine ständische, sondern nur eine rechtliche Trennung zwischen diesen Gruppen. Das war zur Zeit der Turnierbücher anders: damals kämpfte das Patriziat um seine Turnierfähigkeit, um die Gleichberechtigung mit dem Landadel, und fing an, das aus Handelsgeschäften erworbene oder vergrößerte Vermögen in Rittergütern anzulegen. Damals suchte man in den Ahnentafeln nach Verbindungen mit dem Landadel, erfand oder ergänzte sie wohl auch, während zur Zeit des Bertold Pfinzing und des Herdegen Holzschuher ein solches Bedürfnis gar nicht aufgetaucht wäre, da des Königs Schultheiß und die Inhaber des Handlungshauses ohnehin im Landgericht gleichberechtigt und gleichgeachtet neben den Edelleuten vom Lande saßen, zudem Vettern der letzten Grundlacher, die ihre Erbtochter in ein Dynastengeschlecht verheirateten und eben damals den Bamberger Bischofsstuhl mit einem der Ihren besetzten. Wahrscheinlich war es auch gar nicht so wichtig, wie im 19. Jahrhundert, woher man im Mannes- oder Namensstamm kam. Die Stromer verdankten ihren Namen der Einheirat in ein anderes Dienstmannengeschlecht, das der Forstmeister Stromer [USt 60, 15-61, 2.], und stritten sich um ihr Wappen mit den (demnach wohl stammverwandten) Nützel [USt 74, 27 ff.]. Die Bamberger Zolner nannten sich auch Geyer [ Arneth in Jahrbuch f. frk. Landesforschung 1956, S. 256 f.] die Muffel, Weigel und Neuenmarkt waren eines Stammes und Wappens [ Hirschmann in Mitt. Nürnberg 1950, 260 ff.], dagegen gab es Bamberger Haller, die nicht zum Stamme der Nürnberger gehörten, und Geyer in Bamberg führten das Wappen der Pfinzing. Die Lebenshaltung dieser Ratsbürgerfamilien war gehoben: sie hatten Vermögen und Ansehen, der Luxus ihrer Zeit stand ihnen zur Verfügung. Bei den Holzschuhern kauften sie sich zur Kleidung flandrische Tuche, rot und grün und blau, sie trugen bei ihren Ritten übers Land Lederkoller oder Waffenrock und blaue Tuchhandschuhe, die Herrin des Hauses konnte man in Blau, Rot oder Scharlach gekleidet sehen. Rat und Gericht, ja das höchste Amt der Stadt, das Schultheißenamt, war in den Händen der „Freunde", der Verwandten, und wenn Kaiser oder Herzöge nach Nürnberg kamen, stiegen sie bei einem Vetter ab. Urkundenzeugen, Ratsgenossen, Geschäftsteilhaber oder Mitgesandte waren stets Verwandte des gleichen Kreises; man heiratet untereinander und kannte einander, man lebte im Familiendenken. Etwas von diesem Familienstaat hat sich ja in Nürnberg in veränderten Zeitverhältnissen bis zum Untergang der Reichsstadt erhalten.
Die 1764 im Mannesstamm ausgestorbenen Pfinzing sind eine der ersten und größten dieser Familien. Die ersten Pfinzing erscheinen auf den AHNENTAFELN der großen Nürnberger, Ulman STROMER, Martin BEHEIM, Melchior PFINZING, Willibald PIRKHEIMER, des größten Generalgouverneurs von Niederländisch Indien Gustav Wilhelm von IMHOFF; aber auch Eduard MÖRIKE und Wilhelm HAUFF, SCHELLING und Wilhelm WUNDT, Karl HEGEL und Graf STILLFRIED, {S. 61, MVGN 49 (1959) Pfinzing} Prinz ISENBURG, die SCHAFFGOTSCH und der russische Feldmarschall Peter von SAYN-WITTGENSTEIN, Anton FUGGER, die WINDISCHGRÄTZ und LÖWENSTEIN, die Kaiserinnen ELISABETH und ZITA von Osterreich, LEOPOLD III. von Belgien, CHARLOTTE von Luxemburg und die Kinder des Kronprinzen RUPPRECHT stammen von ihnen ab. Die ganze Nürnberger Geschichte ist eng mit ihrem Wirken verbunden. Mit Recht konnte ein Genealoge des 17. Jahrhunderts von ihnen sagen [Staatsarchiv Nürnberg, Nbgr. Hdschr. 439• f. 330.]: "Die Pfinzing sindt stadthaffte ansehnlige Leute gewest, rechte Indigene, die bey dieser Stadt lange Zeit herkommen." In gewisser Weise sind sie typisch und bezeichnend für ihre ganze Schicht gewesen.
Exkurs I: HOLZSCHUHER (5945)
Stammvater der Holzschuher ist, wenn wir von einem älteren Heinrich 1228 (wohl seinem Vater) absehen, ein 1242/79 viel genannter Nürnberger Bürger Heinrich Holzschuher, als dessen Söhne die Brüder Friedrich, Herdegen, Lupold und Heinrich mehrfach bezeugt sind[ zusammen 1287 (NUB 746), vgl. Kraft in Mitt. Nürnberg 1934, 14.]. Friedrich ist 1277/1321, Herdegen 1277/1318, Leupold 1287/1315, Heinrich 1287/1324 urkundlich erwähnt. Chroust hält Herdegen (mit seinen Söhnen Heinrich und Herdegen urkundlich 1319) und Heinrich für die Inhaber des Handlungshauses Holzschuher, die Verfasser des Handlungsbuchs, Bertold Pfinzing für den Schwiegersohn Herdegens. Neben Heinrich 1242/79 kommt Arnold 1259/72 vor, der 1259 die Propstei Fürth pachtet; Heinrich hat Eichstätter Lehen in Mitteleschenbach [ NUB 385, 746a.]. Unter den Urkunden, die Heinrich erwähnen, sind nun folgende auffallend [NUB 306, 328, 448, 608.]:
1242 Heinrich Holzschuher ist unter anderen Zeuge nach den Würzburger Kanonikern F. und A. von Gründlach und dem weltlichen Lupold von Gründlach, der im Rang noch vor dem Butigler steht.
1246 Herdegen von Gründlach schenkt dem Deutschorden ein Gut, nach adligen Zeugen folgen die Bürger Herdegen Schieg, Meinwart und H. Holzschuech.
1271 Der Bischof von Bamberg nennt in einer Urkunde für das Predigerkloster in Frauenaurach Herdegen von Gründlach den Hauptgründer dieses Klosters. Er steht mit seinem Sohn Herdegen an der Spitze der Zeugen, als letzter (und einziger Bürger) folgt Heinrich Holtschuher.
Um 1279 Ritter Herdegen von Gründlach stiftet für sein und seiner verstorbenen Gemahlin Irmentrud Seelenheil Einkünfte an Kloster Heilsbronn. Erste geistliche Zeugen: Liupold und Liupold von Gr?ndlach, Bamberger Kanoniker; letzter (und einziger bürgerlicher) Zeuge H. Holtscuher.
Zweifellos steht also der Nürnberger Bürger Heinrich Holzschuher den Reichsministerialen von Gründlach verwandtschaftlich nahe. Die Namen Friedrich, Herdegen und Lupold, die die drei älteren Söhne Holzschuhers tragen, sind ausgesprochene Namen der Familie von Gründlach. Lupold hieß der Vater des 1246/71 erwähnten Herdegen von Gründlach, der Propst Lupold von Gründlach von St. Stefan in Bamberg (1272-83) scheint der Bruder, der Dompropst und Bischof (1296 bis 1304) Lupold von Gründlach der Sohn des Herdegen zu sein. Dieser Befund legt den Schluß sehr nahe, daß die Gemahlin des Heinrich Holzschuher, die Mutter {S. 62, MVGN 49 (1959) Pfinzing } seiner 4 Söhne, eine Schwester Herdegens und des älteren Propstes, eine Tochter des 1226/46 erwähnten Lupold von Gründlach gewesen sein muß. Was hätte sonst der Nürnberger Bürger als einziger seines Landes bei ausgesprochenen Familienstiftungen der Gründlacher zu suchen gehabt, wie hätte er seinen Söhnen die spezifischen Namen dieses Dienstmannengeschlechts geben können? Der Name Herdegen ist zudem ein ausgesprochen seltener Name; ein Herdegen von Wiesenthau wird 1216, ein Herdegen von Wiesenthau und ein Herdegen Keim im Handlungsbuch der Holzschuher genannt, dazu trafen wir 1246 Herdegen Schieg an. Ulman Stromer nennt sechs Herdegen: zwei Holzschuher, einen Schoppen (einen Nachkommen von Friedrich Schoppen, der eine Holzschuher heiratete), Herdegen Beheim (einen Enkel des Fritz Pfinzing und damit Urenkel einer Holzschuher), den zu Ofen gestorbenen Herdegen Vorchtel und einen Sohn des Swarz Küdörfer 12`) Eine Abstammung aller dieser Namensträger von den letzten Gründlachern und ersten Holzschuhern ist durchaus möglich, ja naheliegend. Demnach dürften die Nürnberger Gewandschneider Holzschuher in weiblicher Linie Nachkommen der Reichsdienstmannen von Gründlach sein, von denen Herdegen 1155/91 (zuletzt vor Neapel) im Dienste der Staufer eine Rolle spielt 12 [ [vgl. bes. Bosl in 69. Jahresbericht d. Hist. Ver. Mittelfranken 1941, S. 29 ff. und Mitt..Nürnberg 1944, 69.].
Exkurs II: E S L E R (6165)
Ulman Stromer nennt 2 Brüder und 3 Schwestern Esler: Conrad Esler, den guten Richter, der (von seiner Frau Pfinzing) 3 Töchter hatte (die mit Hermann Eisvogel, dem Münzmeister von Bamberg und dem Graser verheiratet sind), Rüdiger Esler, der ebenfalls 3 Töchter hatte (mit Wolfram Stromer, Staudigel und Koler vermählt), ferner die Frau des Konrad Stromer (Ulmans Goßmutter), die Frau des reichen Heinz Groß (die Stiefmutter des Stifters Konrad Groß) und die Frau des Sebot Pfinzing. Es ist seltsam, daß Ulman den Gramlieb Esler nicht nennt, der 1290/1314 urkundlich vorkommt, mehrfach ausdrücklich als Konrads Bruder bezeugt, und den Mannesstamm seiner Familie fortsetzt. Dagegen ist Rüdiger Esler in Nürnberg urkundlich nicht erwähnt. Dennoch halten wir Gewins Versuch, ihn mit dem Landrichter Rüdiger von Brant gleichzusetzen und die ganze Familie von den Ministerialen von Dietenhofen abzuleiten [J. P. J. Gewin, Blüte und Niedergang hochadeliger Geschlechter im Mittelalter, s'Gravenhage 1955, S. 173-177.], in der vorgetragenen Form für abwegig. Konrad Esler erscheint in Nürnberg 1287/1319 urkundlich und zwar 1290/ 1316 als Schultheiß; die vereinzelt als Schultheißen genannten anderen Personen - Sifrid (von Kammerstein) 1303, Heinrich Geusmid 1306, Erkenbert Koler 1311 - dürften, wie dies auch später vorkam, als Stellvertreter des vorübergehend abwesenden Schultheißen dem Gericht vorgestanden haben. Konrad Esler war 1295 zugleich Schultheiß von Neuenmarkt. Der Schultheiß und „gute Richter" Konrad Esler wird wohl nicht mit dem Ritter Konrad von Dietenhofen 1275, eher mit dem 1276 in Bamberg genannten Konrad, Sohn des alten Konrad Esler identisch sein. Der ältere Konrad wird in Bamberg seit 1253 genannt, 1264 mit seinem gleichnamigen Bruder Konrad; sie waren möglicherweise die Stammväter der späteren Bamberger Rotesel und Swarzesel [Arneth in Jahrb. f. fränk. Landesforschung 16, 1956. 5. 242: NUB 550. 894.]".
Nachkommen von Konrad Eslers Schwiegersohn Hermann E i s v o g e l nennt Ulman Stromer verschiedentlich, so unter den Gestorbenen Hermann Eisvogel vor den Predigern, seinen Sohn Peter (+ in Ungarn), Ulrich den Wegmeister und Ulrich +1406. Als Geschwisterenkel, also Kinder Hermanns und der Eslerin, {S. 63, MVGN 49 (1959) Pfinzing} bezeichnet er „Ulreich Eysvogel und sein bruder Peter ir swester Zennerin und ir swester Hainreich Forchtlin". Unter den Gestorbenen treffen wir wieder „Hainreich Vorchtel des Eysvogels ayden", vielleicht gehört zu ihm „Herdegen Vorchtel der zu Ofen starb", ein Holzschuhernachkomme; ferner „Cunrat Zenner het dez Eysvogels tochter ) [USt 91. 16; 72, 31; 87, 9 : 87, 12; 94, 6. ]
Exkurs IIl: EBNER (6147)
Der erste urkundlich erwähnte Ebner ist Albert Ebener 1251/63. Seine Söhne dürften die wiederholt [ NUB 570, 680, 884. ] ") als Brüder bezeugten Sifrid Ebner 1265/1304, Hermann 1277/96 und Eberhard 1277/1315 sein. Dazu kommt eine mit Enkelin Zolner verheiratete Nichte der Brüder, Jeut Herolt 1295 [NUB 884.]. Eberhard, der zuletzt Konverse bei den Franziskanern war, hat am 22. 3. 1314 die Kinder Albrecht, Eberhard, Fritz und Agnes (oo Katerpeck). Der bis 1345 erwähnte Fritz, verheiratet mit Els Fürer, war zuletzt Landschreiber (1343) und hatte einen Sohn Fritz. Albrecht, erwähnt 1304/44 am Salzmarkt, beherbergte 1323 Ludwig den Baiern; seine Kinder sind Albrecht, Jakob, Fritz, Paul und Simon, Kunigunde (OD Ott von Vorchheim) und Margret (oo Hermann Beheim) [Regesten Stadtarchiv 16. 11. 1347. dazu USt 86, 18 (nur hier Simon).]. Drei Brüder, die am 9. 12. 1323 genannt werden, sind Konrad, Hermann und Fritz, wohl Söhne Hermanns 1277/96. Als Söhne des ältesten und bedeutendsten Bruders, des langjährigen Schöffen und Beisitzers im Landgericht, Sifrid, sind Heinrich und Siegfried 1303 bezeugt [Kraft in Mitt. Nürnberg 1934, 29 Ziffer 49.]. Zu ihnen muß auch Konrad gehören, der 1298/1305 vorkommt und am 23.8.1305 mit Götz Schopper eine Anleihe an König Albrecht I. gibt. Am 8.7.1308 zeugt Bigenot, Herrn Chunrat Ebeners selig ältester Sohn, daß er, wenn er zu sinen tagen chomen wer, über seine minderjährigen Geschwister die Vormundschaft mit seiner Mutter Wort und einem Sechserrat seiner Freunde führen wolle. Diesen Sechserrat bilden väterlicherseits die Herrn Sifrit Ebener, Herdegen Holzschuher und Albrecht Ebner, mütterlicherseits Erkenbrecht Koler, Berchtold Pfinzing der jüngere und Chunrat Pfinzing Herrn Chunrats Sohn. Schließlich verkauft Bigenot Äcker vor dem Laufertor, die er von seinem Ahnherrn Ritter Bigenot geerbt hat [Regesten Stadtarchiv, auch bei Gatterer 1308 Mo. v. St. Mang. Es besteht also auch eine mütterliche Verwandtschaft mit Pfinzing.] Am 14. 1. 1335 wird in einer Stiftung des Bertold Pfinzing und der Jeut Ebner der Heilsbronner Mönch Berhtold Pignot und sein Bruder Hans Ebner erwähnt. Demnach dürften Konrad (t 1305/8), Jeut (oo Pfinzing) und die am 21. 1. 1332 als Nonnen in Engelthal erwähnten Dyemuot, Cristein und Elspet Ebner ebenfalls Kinder des Sifrid sein. Bei einer Stiftung des Bertold Pfinzing, die seine Schwägerin Cristein Ebnerin verwalten soll, treten am 25. 5. 1333 Albrecht, Hermann und Fritz Ebner - offenbar Vettern - auf. Von der zweimal von Bertold Pfinzing erwähnten Nonne Christine Ebner (1277 bis 1356) wird ohnehin berichtet, vier ihrer Schwestern seien im Kloster gewesen [Dazu Hans Hümmler, Helden und Heilige S. 588.] Bertold Pfinzing hat am 25. 5. 1333 einen Garten vor dem Tiergärtnertor, der ehemals der Pigenot war. Demnach m?ßte entweder Sifrid Ebner oder sein mutmaßlicher Vater Albert Ebner mit einer Bigenot verheiratet gewesen sein. Dazu erinnern wir uns, daß 1288 ein Bigenot Pfinzing, wohl Sibotos Sohn, erwähnt ist. Die B i g e n o t treten im Nürnberger Urkundenbuch nur mit Konrad Bigenot 1226/51 {S. 64, MVGN 49 (1959) Pfinzing} auf, der 1226 Schultheiß war und 1234 einen Sohn Hermann hatte [NUB 210 (scultetus Conradus), 1236 Conrad Bigenot quondam scultetus (NUB 278-281), filius Hermann (NUB 255).]. Der Name Hermann bei den Ebner könnte also auf die Bigenot zurückgehen, falls Alberts Frau etwa eine Tochter dieses Hermann Bigenot war. Der 1308 erwähnte Ritter Bigenot ist allerdings im Urkundenbuch nicht faßbar.
Exkurs IV: Die Familie des Konrad GROSS (6908)
Der Schultheiß und Spitalstifter Konrad Groß, den Pfeiffer den "bedeutendsten Nürnberger des Mittelalters" genannt hat [Pfeiffer in Mitt. Nürnberg 1958, S. 7.], war ein Sohn des reichen Heinz Groß und seiner ersten Frau Suffein (36), später als Sofie von Vestenberg bezeichnet. Konrads Frau Agnes kommt 1322, 1340 und 1343 urkundlich vor. Die vollständigste Auskunft über seine Kinder gibt das Testament seines gleichnamigen Sohnes Konrad vom 29. 9. 1397 (35). Er erwähnt seine Geschwister: Heinrich, des Stifters Sohn, seine Hausfrau Anna, sein Sohn Friedrich, Leupold, des Stifters Sohn, seine Frau Maria, Friedrich, des Stifters Sohn, der über mer waz, seine Frau Hayle, Cunrad, des Stifters Sohn (der Erblasser), seine Hausfrau Anna, Ulrich Hallers Tochter, Anna Geuderin, Konrad Groß Tochter, ihr Sohn Konrad Geuder, meiner Swester Sun Günter Lisperger", ferner die „Freunde" Konrad Mendel und Peter Groß. Von seiner eigenen Familie nennt er die Tochter Els im Katharinenkloster, die Enkelin Jungfrau Clara im Katharinenkloster, die Tochter Kathrey mit ihrem Wirt Dietrich Hegneyn und die Püchelbergerin, eine Tochter der Kathrey Hegneyn „bei Heinz Kürsner". Diese Urkunde erklärt verschiedene frühere Erwähnungen: so daß Konrad Groß, der Stifter, bei den Jahrtagsstiftungen vom 16. 8. 1340 und 18. 2. 1343 seinen Sohn Fritz als einziges seiner Kinder erwähnt (er war also damals offenbar schon gestorben); daß er in den Stiftungsurkunden vom 13., 14., 16. und 18. Febr. 1343 Ulrich Haller „meinen lieben Sweher" nennt (es muß wohl bedeuten: Gegenschwäher), daß er am 16. 2. 1343 „Heinrich Liezzberger und Heinrich Mennlein meine eiden" nennt [vgl. dazu USt 92, 22: Haynreich Mendel an sant Diligen Gazz, Markart sein son, der Kartuser Kloster stift ... und Mitt. Nürnberg 1944, 106 (fälschlich Konrad baut 1380 Kartause). Reicke, Gesch. der Reichsstadt Nürnberg S.286.]. Der Sohn Heinrich war nach Konrad Groß (1338-56), den er schon 1351 und 1353 im Gericht vertreten hatte, von 1356-62 Schultheiß, dann Heinrichs Sohn Friedrich 1362, Konrad 1363-65. Heinrich Geuder, der das Schultheißenamt als Gemahl der Anna Groß 1366-85 innehatte, dürfte der Schwiegersohn des jungen, nicht des alten Konrad Groß sein, sowohl dem Alter nach wie auch deshalb, weil er nie unter den Schwiegersöhnen des Alten genannt wird. Leupold Groß ist zweifellos der Münzmeister von 1368/69, 1372 mit seinem Sohn Andreas genannt; am 6. 2. 1391 erwähnt der König Andreas und Leupold Gebrüder Groß genannt Reichheinz, unsere Münzmeister.
Woher aber stammte die Frau des Stifters, Agnes? Daß sie keine Haller war, wie man aus den Urkunden von 1343 geschlossen hat, ist nunmehr klar. Spätere Genealogen nennen sie eine Pfinzing und geben sie dem 1361 gestorbenen Bertold Pfinzing, Tuchers Eidam, zur Tochter; auch das ist zeitlich unmöglich. Die Lösung der Frage gibt Konrad Arneth in seiner wertvollen Untersuchung über die Familiennamen des Hochstifts Bamberg [Jahrb. f. Tränk. Landesforschung 16, 1956, S. 256/257 und Tafel S. 299.]. Im Totenbuch der Nürnberger Franziskaner steht: „Anno 1342 obiit Agnes filia sculteti de Babenberg uxor Cunradi Divitis, {S. 65, MVGN 49 (1959) Pfinzing} sepulta in ecclesia ante altare S. Ludewici" [ Arneth S. 257 nach Barfüßernekrolog (St. Bibl. Bamberg J. H. Mscr. hist. 49, 24a). Der Barfüßereintrag wird durch die gelegentliche Erwähnung eines Eidams Kunrad bei Friedrich Zolner bestätigt.] . Arneth weist nach, daß sie eine Tochter des Bamberger Schultheißen Friedrich Z o 1 n er, erwähnt seit 1291, Schultheiß 1307-24, t 7. 9. 1325, und seiner ersten Frau Agnes war (aus zweiter Ehe mit Elsbeth hatte er u. a. auch eine Tochter Agnes, verheiratet mit Heinrich Sampach). Dieser Friedrich Zolner, auch Geyer genannt, war ein Sohn des Friedrich Geyer (auch Zolner genannt) und der Agnes Zolner. Eine Schwester des Schultheißen Friedrich Zolner war Gertrudes (t 1313), laut Wappen mit einem Groß in Nürnberg verheiratet. Arneth hält den älteren Friedrich Geyer für einen Nürnberger, der in Bamberg einheiratete. Diese Geyer führen das Wappen mit Geier (Adler?) und Ring, das auch die Pfinzing gebrauchen, nach Arneth das Wappen der Geuschmid (denen sonst der gold/schwarze Schild zugeschrieben wird). Daher möchten wir vermuten, daß Agnes, die Frau des Stifters Konrad Groß, zum Sippenkreis der Pfinzing gehörte. Damit würde sich zwanglos die Einfügung der Sippe des Konrad Groß in die ältere Schultheißensippe erklären.
BEILAGE 1333, Mai 25.
Ich Berhtolt Pfintzinch der Elter burg(er) ze Nurnberck v(er)gihe offenlich an disem brif, Daz ich mit gesamt(er) hant frawe(n) Jeuten meiner elichen wirttin daz guot ze Sperbeslo, daz ich chauft vmb den pfarren ze Ernschirchen, daz aigen ist und daz ieriglich giltet Sehs Sumer chorns, ahtzehen kese und Neun huener, han halbz geschaft durch got an daz closter ze Engelntal, Mit der bescheidenheit, daz si von demselb(e)n halsteil dez guotz ieriglich unser beider iarzeit begen sollen vn(d) suln den frawen in dem closter ahn pittantzz da von geb(e)n zu der selb(e)n iarzeit. vn(d) dez selben Selgeretz sol pflegen Swester Christrein di Ebnerin meiner wirttin Swester di weil si lebt und nach ir tode sullen dez selb(e)n Selgeretz pflegen zwo swester wer die sein, di in dem vorgenante(n) Closter ze Engelntal dez almusens pflegen, vn(d) di selb(e)n zw swester suln dann daz ieriglich auz rihten nach irn t(ru)wen als si got dar vmb antw(e)rten wollen, nach rat mein und meiner wirttin frwnden di in dem closter sein, also, daz ez ewiglich beste und furgank habe, vn(d) also gib ich den vorgenanten frawen dez closters ze Engelntal daz halb guot, mit gesampter haut lediglich auß, mit allem nuotzze und rehten vn(d) zu dem selben halb(e)n guot gehoert ze dorfe und ze velde besucht und vnbesucht ze hab(e)n und ze nizzen fuer rehtes aigen ewiglich. also daz si daz halb guot weder versetzzen, verkaufen noch verkuemern suln noch enmuegen. wann ich wil daz ez ewiglich zu dem Selgeret gehor. Vn(d) dez geb ich in disen brif versigelt mit der Stat ze Nurnb(er)g insigel daz dar an hangt. Dez sein zueg di ersam(en) mann her albreht, her h(er)man, her fritzze di Ebner, her h(er)man Eysuogel und ander gnuk. Der brif ist geb(e)n an Eritage ze pfingesten do man zahlt von gotz geburt dr(e)wzenhund(er)t iar vn(d) in dem dr(e)w vn(d) dreizzigstem iar.
(Hauptstaatsarchiv München, RSt Nürnberg Ü 457)
|
|
|
|